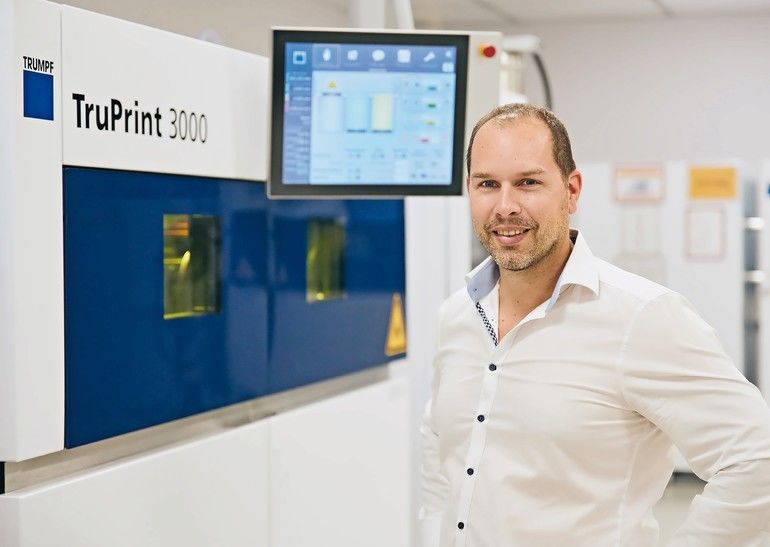Das 2006 gegründete Unternehmen Continental Engineering Services GmbH (CES) mit Sitz in Frankfurt entwickelt und produziert Lösungen für die Automobilindustrie. Die weltweit etwa 1800 Mitarbeiter entwickeln und fertigen schwerpunktmäßig Elektronikkomponenten, Bremsen, Antriebe und Fahrerassistenzsysteme. Viele ihrer Kunden stellen Sport- und Luxuswagen her. Ihre Anforderungen sind für gewöhnlich besonders hoch. Die Bauteile sollen optisch herausstechen und besonders belastbar sein.
Dafür ist die additive Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, sehr gut geeignet. Komplexe Formen meistern additive Verfahren problemlos. Da sie nur dort Material auftragen, wo es benötigt wird, lässt sich Gewicht einsparen. Außerdem erlaubt es der 3D-Druck, kleine Stückzahlen wirtschaftlich zu fertigen. Schließlich müssen Hersteller keine Werkzeuge erstellen oder Fräsmaschinen einrichten.
Nur wenige Automobilhersteller fertigen bislang additiv
Trotz dieser Vorteile ist die additive Fertigung in der Automobilindustrie eher eine Randerscheinung. Manche Hersteller drucken bereits funktionale Prototypen, Ersatz- oder Einzelteile. Serienfertigungen sind hingegen selten. Hier leistet CES Pionierarbeit. Als einer der wenigen Hersteller überhaupt hat das Unternehmen im Jahr 2017 einen eigenen Bereich für Additive Manufacturing gegründet: das Kompetenzzentrum Additive Design and Manufacturing, kurz ADaM. Mittlerweile arbeiten dort 20 Mitarbeiter, Stefan Kammann leitet den Bereich.
Die meisten 3D-Drucker bei ADaM drucken Bauteile aus Kunststoff. Die Mitarbeiter stellen damit Prototypen und Testbauteile her. „3D-Druck ist bei kleinen Stückzahlen schneller als fräsen oder druckgießen. Das verkürzt die Entwicklungszeiten“, sagt Kammann. Außerdem verwenden Mitarbeiter die additive Fertigung, um ihre automatisierten Produktionslinien einzurichten. Soll zum Beispiel ein Roboter nach einer Platine greifen, müssen sie ihm das erst einmal beibringen. Additive Fertigung erlaubt es, eine vereinfachte Version der Platine herzustellen. Anschlüsse oder Halterungen, die der Roboter ohnehin nicht berührt, sparen die Mitarbeiter aus. Das ist günstiger, als eine Originalplatine zu benutzen, die nach den Tests unbrauchbar ist.
Seit Januar 2018 druckt CES auch Bauteile aus Metall. Dafür verwenden sie zwei Modelle der 3D-Drucker-Anlage Truprint 3000 von Trumpf. Auf das Technologieunternehmen aus Ditzingen vertraut CES schon lange. Mittlerweile umfasst der Maschinenpark über zehn Trumpf-Anlagen, mit denen die Mitarbeiter Bleche schneiden, schweißen oder biegen. Da die Erfahrungen mit den Maschinen sehr positiv sind, setzt der Automobilzulieferer auch beim metallischen 3D-Druck auf Trumpf.
3D-Druck verbessert Oberflächen bei Automobilbauteilen
Kammann greift auf die beiden Truprint-Anlagen zurück, wenn er Teile mit hochwertiger Oberfläche benötigt. „So eine schöne, glatte Fläche bekommen wir nur mit 3D-Druck hin“, sagt Kammann und streicht über ein glänzendes Gaspedal. „Bei einem Kunden, der Luxusautos herstellt, macht das einen ganz anderen Eindruck“, so der Bereichsleiter.
Auch Gehäuse für Spiegel, Displays oder Steuerungen stellt er additiv mit der Truprint 3000 her. Außerdem druckt das Unternehmen mit den Anlagen Teile für die eigene Fertigung. Die Mitarbeiter seien mit der Schutzgasdüse für die Roboterschweißzelle unzufrieden gewesen. Kühlkanäle, Bohrleitungen und Fluidströme haben nicht den Anforderungen entsprochen. Deshalb haben die Ingenieure kurzerhand ein neues Bauteil konstruiert und gedruckt, das sich konventionell gar nicht fertigen lässt. Jetzt verteilt sich das Schutzgas in der Zelle gleichmäßiger.
Gedruckte Bremssättel bremsen besser
Besonders stolz ist Kammann auf einen Bremssattel, den er gleich für mehre Hersteller mit der Truprint 3000 produziert. Solche Serienbauteile sind in der Branche bislang eher selten. Zulieferer müssen sich dafür eine Straßenzulassung einholen. Das ist kompliziert und aufwendig. Mit zahlreichen Tests müssen sie nachweisen, dass sich das gedruckte Bauteil auf der Straße genauso verhält wie das konventionell gefertigte.
„Das schafft nicht jeder, denn man muss die Prozesse und die Qualitätsanforderungen genau kennen“, sagt Kammann. Beim Bremssattel haben die ADaM-Mitarbeiter neben Scans mittels Computertomographie und Zugproben auch Lastwechseltests durchgeführt. Dafür haben sie zirka 30 000 Mal hohen Druck auf die Bremse ausgeübt. Das Ergebnis: Die Belastbarkeit war beim gedruckten Bremssattel am Ende höher als bei dem konventionell gefertigten.
„Damit konnten wir unseren Kunden überzeugen, den Bremssattel künftig additiv herzustellen“, sagt Kammann. Außerdem punktet der additiv gefertigte Bremssattel mit einer kürzeren Produktionszeit. Mit dem klassischen Sandgussverfahren beträgt die Lieferzeit etwa 12 bis 14 Wochen, mit 3D-Druck dauert es nur eine Woche. Beim Bremssattel lohnt sich 3D-Druck bei Kleinserien. Bei größeren Bestellungen ist die konventionelle Fertigung günstiger.
Automobilindustrie muss offener für
additive Fertigung werden
Für die Zukunft wünscht sich Kammann bei seinen Kunden aus der Automobilindustrie mehr Offenheit gegenüber dem 3D-Druck. Denn am Ende entscheidet immer der Erstausrüster über das Herstellungsverfahren. Hier gebe es laut Kammann oft noch Vorbehalte, dass die Technologien nicht ausgereift und die Validierung zu aufwendig seien. Bei CES ist diese Sorge unbegründet. „Wir haben alle gängigen Verfahren im Haus und verwenden die additive Fertigung nur, wenn wir uns davon Mehrwerte versprechen. Vor allem bei komplexen Kleinserien sind die Chancen immens. Davon wollen die Hersteller von Sport- und Luxuswagen überzeugen“, sagt Kammann.
Trumpf GmbH + Co. KG
www.trumpf.com